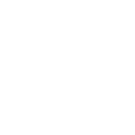LocalZero:Fragen und Antworten zum Thema Kosten, Finanzierung und Personalaufbau
Unterseite von LocalZero:Die Klimavision für jeden Ort
Kosten in der Klimavision
Frage: Warum ist es laut der Klimavision teurer, je später wir den Zeitpunkt der Klimaneutralität angeben?
Antwort: Das hängt v.a. mit der in der Klimavision angenommenen jährlichen Sanierungsrate im Gebäudesektor inkl. Umstellung auf erneuerbare Hauswärme (4 %) zusammen. Je mehr Häuser zum Zeitpunkt der angestrebten Klimaneutralität saniert sind, Der Energiebedarf für Raumwärme und Warmwasser im Sektor PH (Gebäude), der im Jahr der Klimaneutralität nicht durch Wärmepumpen, Solarthermie, Biomasse, erneuerbare Fernwärme oder elektrische Heizungen gedeckt wird, muss anderweitig ins Haus kommen. Das wird in der Klimavision durch e-Methan gelöst. Die Sanierung und Umstellung auf erneuerbare Wärmesysteme im Haus ist teurer als die Bereitstellung von e-Methan. Deshalb sind die Gesamtkosten zum späteren Zeitpunkt (höherer Sanierungsstand) höher.
Frage: Wie kommen die Zahlen zu den vermiedenen Klimakosten zustande?
Antwort: Grundlage für diese Annahme ist die Berechnung des Umweltbundesamts zu Klimafolgeschäden. Die Klimakosten pro t CO2e werden mit 195€/t CO2e so konservativ wie vom Umweltbundesamt (2020, S.8) möglich angenommen, daher auch nicht für spätere Jahre angepasst. Daraus folgt, dass jede gesparte Tonne CO2e (z.B. durch eingespartes Gas und Ersetzung durch Wärmepumpen oder erneuerbare Fernwärme) durch unterschiedliche Maßnahmen der Sektoren aus der Klimavision direkt Klimafolgekosten spart.
Investitionen
Die ausführlichen Annahmen und Berechnungen können Sektor für Sektor hier entnommen werden. Beispielhaft für die Sektoren Wärme und Strom gilt:
Von dem Fernwärmebedarf wird dann der Leistungsbedarf und die Investitionen abgeleitet: Statt klassischer Fernheizwerke werden Solarthermiefelder aufgebaut, dazu Großwärmepumpen und Geothermie-Anlagen. Die pauschalisierten Investitionskosten stammen aus der Fraunhofer-Studie „Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem“
Im Strombereich bzw. für den Netzausbau auf den verschiedenen Spannungsebenen werden die Kosten gemäß [ISE2020b] angenommen. Analog zu den oben beschriebenen überregionalen Quellen (Wind offshore, Tiefengeothermie usw.) werden die Kosten für den HGÜ-Ausbau (für Offshore-Windstrom) nur anteilig der Kommune bei den “extraterritorialen Kosten” zugeschrieben. Dagegen werden die Kosten für Mittelspannungs- und Verteilnetz der Kommune entsprechend dem lokalen Ausbau von Onshore-Wind und PV zugeschlagen.
Personalaufbau
Die ausführlichen Annahmen und Berechnungen können Sektor für Sektor hier entnommen werden. Beispielhaft für die Sektoren Wärme und Strom gilt:
Für die Wärme-Transformation werden Stellen im Anlagenbau benötigt: Dafür wurde der Anteil der Personalkosten (25,5%) an den Investitionskosten im Bauhauptgewerbe (WZ 41.2, 42, 43.1, 43.9) und der durchschnittliche Jahreslohn (47.195 €/a) ermittelt.
Um die Zahl der für die Strom-Maßnahmen erforderlichen Personalstellen (Vollzeitäquivalente) abzuschätzen, wird zunächst der prozentuale Personalkostenanteil am Umsatz der jeweiligen Branche (Anlagenbaubau, Elektro- und Heizungshandwerk usw.) ermittelt und mit der Gesamtinvestition multipliziert. Das Ergebnis wird dann durch die Personalkosten pro Kopf geteilt, die in den meisten Fällen der Quelle [DESTATIS2017] entnommen wurden. Das Ergebnis wird dann mit der Zahl der Beschäftigten in der jeweiligen Branche verglichen und so die Zahl der erforderlichen neuen Stellen bestimmt, falls die vorhandenen Stellen nicht ausreichen. Für die Kommune werden jeweils die bundesweiten Personalzahlen mit dem Verhältnis der Einwohnerzahl Kommune zur Einwohnerzahl Deutschland skaliert.
In einigen Fällen greifen verschiedene Maßnahmen auf den gleichen Pool von Arbeitskräften zu (z.B. Photovoltaik Dach, Fassade, Freifläche und Agri-PV). Es werden dann die vorhandenen Stellen formal anteilig nach dem jeweiligen Bedarf der Maßnahme verteilt, so dass in der Summe nicht mehr vorhandene Stellen ausgewiesen werden als tatsächlich existieren.
Die 2018 vorhandenen Stellen für Windkraft (onshore und offshore) wurden der Quelle [BWE2018] entnommen, für den Anlagenbau in den Bereichen Geothermie und GuD-Kraftwerke (Rückverstromung) der Studie [HBS2015], für Elektro- und Heizungsinstallation der Datenbank GENESIS des Statistischen Bundesamtes [DESTATIS2019] und für Biomasse aus [BBE2016].
Für den Netzausbau wurde wie in Wärme und Kraftstoffe der Anteil der Personalkosten (25,5%) an den Investitionskosten im Bauhauptgewerbe (WZ 41.2, 42, 43.1, 43.9) und der durchschnittliche Jahreslohn (47.195 €/a) angesetzt.